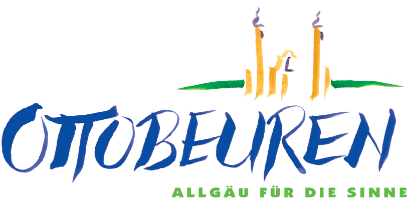15.10.1958 – Hebauf in der neuen Eldernsiedlung
Titel
Beschreibung
Die Wohnungsnot Ende der 1950er Jahre war groß, zwischen 1959 und 1960 entstand deshalb südlich von Ottobeuren die neue „Eldernsiedlung“. Wäre die zusätzliche Beschaffung von Bauland möglich gewesen, dann hätte es sogar zu einem Lückenschluss mit dem – damals nach deutlich kleineren – Kernort kommen können. In Ermangelung neuen Baulands kam die Ortsentwicklung, insb. auch die Entwicklung des Kurortes nicht voran, obwohl weitere Kurbetriebe eröffnen wollten.
Zur Geschichte der Eldernsiedlung gehört die kurz nach der Fertigstellung erfolgte Benennung Gustav-Stein-Straße. Gustav Stein hatte den Bau der Marienorgel in der Basilika ermöglicht. Neben Bürgermeister Josef Hasel war es vor allem Landrat Dr. Karl Lenz, der sich um die Ortsentwicklung verdient gemacht hatte. Für seine besonderen Verdienste wurde dem Landrat sogar die Ehrenbürgerwürde Ottobeurens verliehen. Später wurde nach ihm ebenfalls eine Straße in Ottobeuren benannt. Die Umsetzung der Baumaßnahme in Eldern wurde über die Bayerische Landessiedlung organisiert, während örtliche Baufirmen Aufträge erhielten. Wer dort Wohnraum erwerben wollte, musste sich zum einen zur Kleintierhaltung verpflichten, zum anderen wurde nur an größere Familien verkauft.
Die Entstehung der Eldernsiedlung – zu Ottobeuren gehörig, nicht zu, Ortsteil Eldern – vollzog sich in den späten 1950er Jahren als Reaktion auf die große Wohnungsnot der damaligen Zeit und war eng verknüpft mit den Bemühungen der Bayerischen Landessiedlung (BLS) und der Initiative der Marktgemeinde Ottobeuren und dem Landratsamt des Altlandkreises Memmingen.
I. Der Kontext der Wohnungsnot und die Bundesweiten Anstrengungen
Die Notwendigkeit zur Schaffung von neuem Wohnraum in der Nachkriegszeit war in Ottobeuren, der Geburtsheimat Kneipps, akut. Im Oktober 1958 suchten dort noch 102 Familien eine Wohnung. Landrat Dr. Karl Lenz bezeichnete Ottobeuren als „Brennpunkt im Landkreis“ in der Wohnungsfürsorge.
Die Wohnungsnot war ein bundesweites Problem, das auch auf höchster Ebene bekämpft wurde. In der Bundesrepublik lebten gegenwärtig (Stand Ende 1958) noch rund 375.000 Menschen in Lagern. Um diese Lager schnellstmöglich räumen zu können, plante der Bundeswohnungsbauminister, neben den allgemeinen Wohnungsbaumitteln fast eine Milliarde Mark an Sondermitteln für das kommende Jahr (1959) bereitzustellen.
Im Landkreis Memmingen hatte die Bayerische Landessiedlung in den zehn Jahren vor 1958 bereits rund 350 Wohnungen gebaut und damit einen hohen Prozentsatz der insgesamt etwa 1300 seitdem entstandenen Wohnungen bewältigt.
II. Chronologie der Eldernsiedlung (1958 - 1960)
Die Initiative zur Eldernsiedlung ging maßgeblich von Landrat Dr. Karl Lenz aus, dem „Schöpfer dieser Idee“. Er hatte versprochen, einen entscheidenden Beitrag zur Linderung der Wohnungsnot zu leisten und 50 Wohnungen in Aussicht gestellt.
Herbst 1958: Baubeginn und erste Richtfeste
• Oktober 1958: Die Bayerische Landessiedlung begann mit der Erstellung von Nebenerwerbssiedlungen im Ortsteil Eldern (zwei Kilometer südlich von Ottobeuren). Diese Siedlungen waren speziell für „nachgeborene Bauernsöhne“ gedacht, die sonst nicht in der Lage wären, ein Eigenheim zu erstellen, und sollten ihnen durch günstige Staatsmittel Eigentum und Sesshaftigkeit ermöglichen. Die Wohnungn wurden verlost, zum Zuge kamen keine angestammten Einheimischen, sondern Flüchtlingsfamilien.
• Zu diesem Zeitpunkt waren bereits sieben Siedlerstellen mit 14 Wohnungen im Bau, für die das Richtfest gefeiert wurde.
• Unmittelbar darauf begannen die Arbeiten an vier weiteren Häusern mit acht Wohnungen.
• Die Fertigstellung von insgesamt 22 Wohnungen (11 Häuser) war für das Frühjahr 1959 geplant.
• Weitere acht Wohnungen der BLS sollten im Frühjahr 1959 entlang des einstigen „Herrenwegs“ entstehen, sodass die Landessiedlung 1959 insgesamt 30 Wohnungen zur Verfügung stellen konnte.
• Die Bauunternehmen: Beim Richtschmaus im Oktober 1958 dankte der Sprecher der Landessiedlung der Baufirma Filgis & Co., Ottobeuren, und der Zimmerei Pfalzer, Memmingen, für die rasche und reibungslose Zusammenarbeit. Der Zimmermann Böbel von der Firma Pfalzer sprach den Richtspruch.
• Die kurze Vorbereitungszeit der Planung wurde Landrat Dr. Karl Lenz, dem Landratsamt und der Marktgemeinde Ottobeuren zugeschrieben. Die Marktgemeinde trat den Geländestreifen entlang der „Herrenstraße“ ab.
Zeitgleiche Bautätigkeit der Landeswohnungsfürsorge:
• Bis zum Frühjahr 1959 vollendete auch die Landeswohnungsfürsorge bei der Jugendherberge fünf Häuser mit je vier Wohnungen (20 Einheiten).
• Gesamtbilanz: Bis zum Spätherbst 1959 sollten durch BLS und Landeswohnungsfürsorge insgesamt 50 Familien untergebracht sein, womit die Hälfte der Wohnungssuchenden in Ottobeuren versorgt war.
• Januar 1959: Die Landeswohnungsfürsorge feierte das Richtfest für ihre Gebäude (zwei Doppelhäuser mit insgesamt acht Wohnungen) an der Faichtmayrstraße. Beteiligte Baufirma war Johann Mayer & Söhne.
• Juni 1959: Der Marktgemeinderat beschloss einstimmig, eine Straße im neuen Siedlungsgebiet der Bayerischen Landessiedlung an der Eldernstraße zu Ehren des Rechtsanwalts Gustav Stein in „Gustav-Stein-Straße“ umzubenennen. Gustav Stein, Syndikus des Kulturkreises des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, wurde damit für seine Verdienste um die Finanzierung und das Zustandekommen der „Marienorgel“ in der Basilika Ottobeuren geehrt.
• September 1959: Bei einem Festakt im Rathaus wurde Gustav Stein die Urkunde überreicht. Der Bürgermeister betonte, dass die Straßenbenennung in dieser Eigenheimsiedlung, die Ottobeuren mit Eldern verbinde, eine „geistige Brücke zu Riepp und der Gegenwart“ schlage.
Ende 1959: Fertigstellung und Ehrungen
• August 1959: Die Häuser der Landessiedlung in Eldern waren fertiggestellt, und die neuen Wohnungen sollten in Kürze bezogen werden.
• Dezember 1959: Der Tag der Einweihung der 22 Eigenheime der Bayerischen Landessiedlung in Eldern fiel symbolisch fast mit der Ernennung von Landrat Dr. Karl Lenz zum Ehrenbürger von Ottobeuren zusammen. Diese Ehrung würdigte seine Verdienste um die „Bannung der größten Wohnraumnot“ und andere kommunale Errungenschaften.
Frühe 1960er Jahre: Weitere Entwicklung
• Die Landessiedlung war bereit, weitere Häuser zu errichten, sofern die Frage des Baugrundes geklärt werden konnte.
• Im Februar 1960 wurde im Gemeinderat darüber debattiert, die Ortsgrenze im Süden bis zur Elderner Sägemühle zu verlegen, damit Eldern und Ottobeuren rascher zusammenwachsen.
III. Parallele zur heutigen Wohnungsnot: Der Kampf um Bauland
Schon in den 1950er Jahren war der Mangel an geeignetem Bauland das zentrale Hindernis für den Wohnungsbau. Die Quellen belegen, dass das Vorhaben des sozialen Wohnungsbaus „durch den Mangel an Baugrundstücken unsagbar erschwert“ wurde.
Landrat Dr. Lenz stellte fest: „Niemand gibt solche ab oder nur zu unerschwinglichen Preisen, die nun einmal der soziale Wohnungsbau nicht tragen kann“.
Dies stellt eine deutliche Parallele zur heutigen Wohnungsnot dar:
• Knappheit und Preisexplosion: Damals wie heute behindern überzogene Grundstückspreise den dringend benötigten sozialen Wohnungsbau. Die Quellen zeigen, dass Grundstückspreise erheblich in die Höhe schnellten, was die Landessiedlung daran hinderte, weitere Nebenerwerbssiedlungen zu erstellen.
• Unwille zur Abgabe: Die Quellen beschreiben, dass die Bürger zum Teil kein Geld benötigten und daher geeignetes Gelände nicht veräußerten.
• Kommunale Zwangslagen: Auch die Gemeinde selbst gab 1959 nur zögerlich Grundstücke ab, da diese einem Stoppreis unterlagen und der Erlös daher sehr gering war. Man befürchtete, Grundstücke zu „verschleudern“, und wartete auf die wahrscheinliche Aufhebung der Preisstoppverordnung, damit sich die Preise auf einen „echten Grundstückswert einpendeln“.
• Zersiedelung vs. Verdichtung: Bereits 1960 lehnte die Regierung von Schwaben eine Ausweitung der Ortsgrenze nach außen (wie zur Elderner Sägemühle) ab, um eine zu große und lückenhafte Bebauung zu verhindern. Die Forderung lautete, zuerst den Ort „innerhalb seiner jetzigen Versorgungsanlagen auszubauen“, bevor das Umland systematisch einbezogen wurde, um die finanzielle Belastung des Gemeindehaushalts zu vermeiden. Die Beschaffung von Grundstücken war somit ein „ungemein schwieriges Problem“.
Die damalige Situation war geprägt von dem Konflikt zwischen dem dringenden sozialen Bedarf an erschwinglichem Wohnraum und der ökonomischen Realität des steigenden Grundstückswertes und der Verknappung des verfügbaren Baulandes, was die kommunalen Bemühungen stark belastete.
IV. Weitere Zeitumstände und Bautätigkeit in Ottobeuren
Die Entstehung der Eldernsiedlung fand inmitten einer Phase intensiver Bautätigkeit in Ottobeuren statt, das sich gleichzeitig zu einem aufstrebenden Kneippkurort entwickelte:
• Infrastruktur und Verkehr (1958/1959): Neben den Wohnungsbauten wurden 75 Bauvorhaben (im Jahr 1958) durchgeführt. Dazu gehörten die Erneuerung und Verbreiterung der Lindenbrücke über die Günz, die Verrohrung des Grabens vor dem Friedhof, und intensive Straßenbauprojekte, wie der Ausbau der Verbindung nach Hawangen. Ottobeuren verfolgte das Ziel, rasche und kurze Anschlüsse an die B 18 zu erhalten, was für den Kurort und Fremdenverkehr wichtig war.
• Kurentwicklung: Ottobeuren erlebte einen raschen Aufschwung als Kurort. Die Übernachtungszahlen stiegen von 40.000 (1954) auf 70.000 (1958). Es wurden Kuranlagen ausgebaut, das Kurmittelhaus gekauft und die Erweiterung des Ulrichsheims und des Kurheims „Karlsbad“ geplant. Die Entwicklung wurde jedoch durch den Mangel an Baugrund für neue Kurheime gehemmt.
• Lokale Wirtschaft: Die Firma „Hans Ströbele. Traktoren, Landmaschinen, Kraftfahrzeuge“ feierte im März 1960 ihr 25-jähriges Bestehen in Eldern. Der Betrieb hatte seine bebaute Fläche im Vorort Eldern auf 1800 qm erweitert.
• Kulturelle Höhepunkte: Die Benennung der Gustav-Stein-Straße war eng mit der Einweihung der „Marienorgel“ verbunden, die als Krönung und Vollendung der Werke der Barockmeister Karl Riepp und Johann Michael Fischer in der Basilika galt.
Die Fertigstellung der Eldernsiedlung stellte für Ottobeuren einen wesentlichen Schritt zur „Beseitigung der Wohnungsnot“ dar, ermöglicht durch die Zusammenarbeit von Bauträgern (Bayerische Landessiedlung, Landeswohnungsfürsorge), der Initiative von Landrat Dr. Lenz und dem „Opfersinn der Grundstücksverkäufer“, bei denen „hier das soziale Empfinden mehr sprach als ein materieller Gewinn“.
Die Eldernsiedlung war somit ein Ankerpunkt im schwierigen Aufbauwerk der Nachkriegszeit, vergleichbar mit einem dringend benötigten Stützpfeiler, der in ein instabiles Fundament aus Landknappheit und steigenden Preisen eingegraben werden musste, aber schließlich die notwendige Stabilität für 50 Familien schuf.
___________________
Wie man anhand der Fotos sieht, waren die meisten alle Häuser mit einem Kobel zur Tierhaltung versehen und ganz unterschiedlich genutzt. Gehalten wurden Schweine, Hühner, Schafe und Hasen. An der Eldernstraße und auch im Osten der Eldernsiedlung waren den Bewohnern kleine Parzellen zugewiesen, die zu Versorgung der Tieren gemäht werden durften. Mit Leiterwägen fuhr man raus und mähte teils täglich. Oft genug kam es vor, dass das Heu von jemand anderem abgeräumt worden war. Der Gedanke der Selbstversorgung stand nach dem Krieg genauso im Vordergrund wie schon in den 1930er Jahren beim Bau der Schwabensiedlung („Karl-Wahl-Siedlung“). Bei den Doppelhaushälften waren / sind die Kobel freistehend und mit den Nachbarn geteilt.
Die Häuser wurden von je zwei Familien bewohnt (Erdgeschoss, 1. Stock), Eingang gab / gibt es nur einen. Die Häuser sind unterkellert, geheizt wurde überwiegend mit Holz, später teils auch mit Elektrospeichern. Über die Jahre gab es immer mal wieder Hochwasserschäden, in letzter Zeit drückte auch Grundwasser oder Wasser aus dem Kanal in die Häuser.
Durch Abriss, Umwidmung bzw. Neubau geht der ursprüngliche Charakter der Eldernsiedlung immer mehr verloren (vgl. Haus Nr. 1). Ein Drohnenbild zeigt den Straßenzug im Juni 2021. Ein anderen Fotos zeigt Peppi Wagner, Gustav-Stein-Straße 4, im Dezember 2010, die den „Kühlschrankwettbewerb“ des Energieteams gewann und einen neuen Kühlschrank mit besten Verbrauchswerten erhielt. Ihr Siegergerät (der Firma Bosch) stammte aus dem Jahr 1959, war also beim Einzug angeschafft worden.
Kurioser Fun-Fact: Einzig die Familie Denk, die in der Gustav-Stein-Straße 16 (fast am Waldrand) wohnte, hatte ein Telefon. Frau Zettler berichtete davon, dass man an Weihnachten zu fünft bei Denks auftauchte, um mit den Verwandten in den USA zu telefonieren.
Allgemein spricht man davon, dass es vor allem Flüchtlingsfamilien waren, keine Einheimischen, die kaufen konnten. Die Fremden wollte man nicht im Kernort haben.Da die Nachfrage das Angebot deutlich überstieg, wurden die Häuser verlost.
Über die Entwicklung Ottobeurens nach 1800 schrieb der spätere Abt Vitalis Altthaler (*03.09.1932, Irpisdorf, † 19.01.2022, Ottobeuren) eine lesenswerte Zulassungsarbeit. Die Eldernsiedlung kommt darin zwar nicht vor, für das Versändnis der Ortsentwicklung Ottobeurens ist sie dennoch sehr wertvoll.
Quellen: überwiegend Memminger Zeitung sowie Zeitzeugen-Interviews
___________________
Repros, Fotos, Recherche und Zusammenstellung, Helmut Scharpf, 10/2025